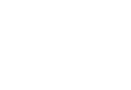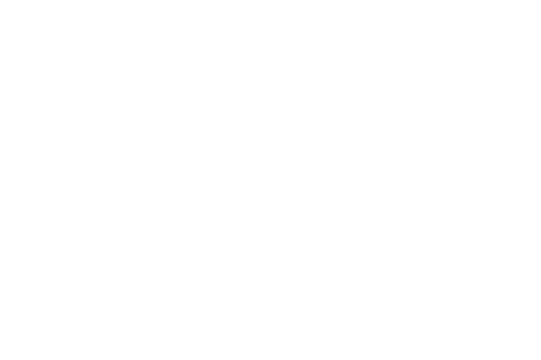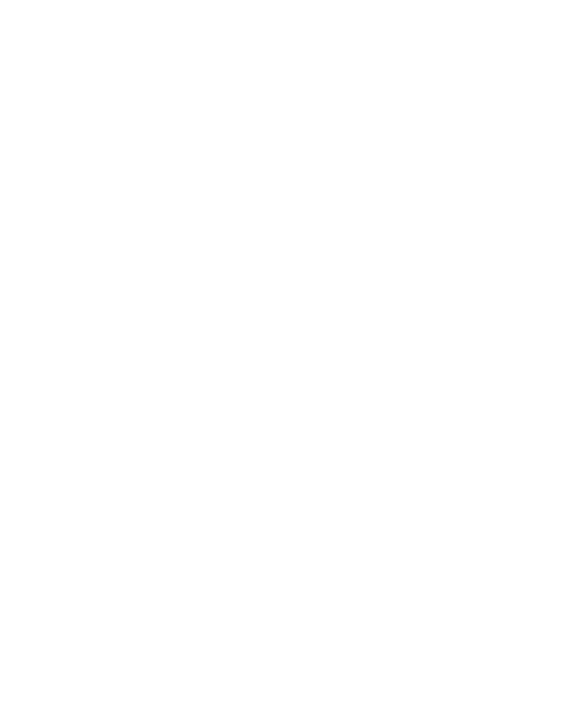10.09.–24.10.2025 / Oper, Konzert
Fidelio
Konzertante Opernaufführung
Ludwig van Beethoven
Termine
19:30 - 22:15
Oper, Konzert
Im Rahmen des 1. Philharmonischen Konzerts
19:30 - 22:15
Oper, Konzert
15:00 - 17:45
Familienkarte Oper, Konzert
19:30 - 22:15
Zum letzten Mal in dieser Spielzeit Oper, Konzert
Beschreibung
Große Befreiungsoper in der Mercatorhalle
Oper in zwei Aufzügen
Libretto von Josef Sonnleithner und Friedrich Treitschke nach Jean-Nicolas Bouilly
Mit Textinterventionen von Katja Petrowskaja
Koproduktion der Deutschen Oper am Rhein und der Duisburger Philharmoniker
Libretto von Josef Sonnleithner und Friedrich Treitschke nach Jean-Nicolas Bouilly
Mit Textinterventionen von Katja Petrowskaja
Koproduktion der Deutschen Oper am Rhein und der Duisburger Philharmoniker
Freiheit, Courage und Menschenrechte sind die existenziellen Themen, die das Fundament von Ludwig van Beethovens einziger Oper „Fidelio“ bilden. Es ist die Geschichte des willkürlich inhaftierten Florestan, dessen ihn liebende Frau Leonore sich entgegen aller Gefahr als Mann verkleidet, um ihn in der Rolle des „Fidelio“ aus dem Kerker zu befreien. Auf dem Weg aus der Gefangenschaft in eine utopisch scheinende Freiheit sprengt die treibende Kraft der Musik formale Grenzen.
Die konzertante Opernaufführung von „Fidelio“ ist eine Koproduktion der Deutschen Oper am Rhein und der Duisburger Philharmoniker. Mit eigens verfassten Textinterventionen erweitert die ukrainisch-deutsche Schriftstellerin Katja Petrowskaja die konzertante Opernvorstellung erzählerisch. Die Texte der Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin eröffnen drängende, aktuelle und historische Perspektiven auf die Freiheitsoper. In der Aufführung werden sie von Schauspieler und Träger des Iffland-Rings Jens Harzer gelesen.
Betitelt mit dem Fidelio-Zitat „Der Menschheit Stimme“ setzt zudem das große partizipative Chorprojekt des UFOs, der mobilen Spielstätte der Deutschen Oper am Rhein am 20. September auf dem Opernplatz ein Zeichen für die Relevanz von Menschenrechten und spannt so einen großen Klangbogen bis zur Philharmonie Mercatorhalle.
Die konzertante Opernaufführung von „Fidelio“ ist eine Koproduktion der Deutschen Oper am Rhein und der Duisburger Philharmoniker. Mit eigens verfassten Textinterventionen erweitert die ukrainisch-deutsche Schriftstellerin Katja Petrowskaja die konzertante Opernvorstellung erzählerisch. Die Texte der Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin eröffnen drängende, aktuelle und historische Perspektiven auf die Freiheitsoper. In der Aufführung werden sie von Schauspieler und Träger des Iffland-Rings Jens Harzer gelesen.
Betitelt mit dem Fidelio-Zitat „Der Menschheit Stimme“ setzt zudem das große partizipative Chorprojekt des UFOs, der mobilen Spielstätte der Deutschen Oper am Rhein am 20. September auf dem Opernplatz ein Zeichen für die Relevanz von Menschenrechten und spannt so einen großen Klangbogen bis zur Philharmonie Mercatorhalle.
Musikalische Leitung
Chorleitung
Texte
Dramaturgie
Besetzung
Leonore
Florestan
John Matthew Myers
Pizarro
Rocco
Marzeline
Jaquino
Don Fernando
Sprecher
Jens Harzer/Thomas Loibl
1. Gefangener
Sookwang Cho/Zheng Xu
2. Gefangener
Sangjun Bak/Attila Fodre
Orchester
„Was es eigentlich bedeutet, ein Mensch zu sein“ – Vitali Alekseenok und Katja Petrowskaja im Gespräch mit Katie Campbell zur konzertanten Opernaufführung von „Fidelio“
Welche Bedeutung hat die Oper „Fidelio“ für euch? Wann und wie habt ihr dieses Werk kennengelernt?
Vitali Alekseenok (VA): Ich habe Beethoven durch seine Symphonien und Kammermusik kennengelernt, erst später kam die Oper „Fidelio“ dazu. Damals habe ich noch kein Deutsch gesprochen und konnte dieses Werk zuerst nicht richtig einordnen. Ich glaube, man muss sich auf diese Oper einlassen, da die meisten Schätze, die darin liegen, etwas versteckt sind. Erst viel später habe ich verstanden, dass Beethoven nicht umsonst so viel daran gearbeitet hat, denn die Oper ist sehr tiefgründig. Er hatte einen Drang, immer idealistischer zu werden, etwas allgemein Menschliches zu erzählen und sich vom Alltäglichen, Konkreten zu entfernen. Diesen Weg konnte ich in meiner Rezeption von Beethoven mitgehen. Obwohl ich „Fidelio“ anfangs eher als eine Perle in der Musikgeschichte wahrgenommen habe, ist es für mich heute, 2025, eines der aktuellsten Stücke.
Katja Petrowskaja (KP): Ich habe „Fidelio“ auch erst sehr spät kennengelernt. Mit Freunden, die an der Manhattan School of Music waren, bin ich in Verdis „Nabucco“ an der Metropolitan Opera gegangen. Ich fand den berühmten Chor der Gefangenen darin so ergreifend, dass mir ein Freund daraufhin den Gefangenenchor aus „Fidelio“ gezeigt hat. Irgendwann habe ich dann auch die ganze Oper gesehen. Daraus hat sich eine Reihe ergeben, die ich immer zusammen rezipiert habe: Der Chor der Gefangenen aus „Nabucco“, aus „Fidelio“ und dann der Chor aus Beethovens neunter Sinfonie als utopische Vorstellung der Verbrüderung.
Vitali Alekseenok (VA): Ich habe Beethoven durch seine Symphonien und Kammermusik kennengelernt, erst später kam die Oper „Fidelio“ dazu. Damals habe ich noch kein Deutsch gesprochen und konnte dieses Werk zuerst nicht richtig einordnen. Ich glaube, man muss sich auf diese Oper einlassen, da die meisten Schätze, die darin liegen, etwas versteckt sind. Erst viel später habe ich verstanden, dass Beethoven nicht umsonst so viel daran gearbeitet hat, denn die Oper ist sehr tiefgründig. Er hatte einen Drang, immer idealistischer zu werden, etwas allgemein Menschliches zu erzählen und sich vom Alltäglichen, Konkreten zu entfernen. Diesen Weg konnte ich in meiner Rezeption von Beethoven mitgehen. Obwohl ich „Fidelio“ anfangs eher als eine Perle in der Musikgeschichte wahrgenommen habe, ist es für mich heute, 2025, eines der aktuellsten Stücke.
Katja Petrowskaja (KP): Ich habe „Fidelio“ auch erst sehr spät kennengelernt. Mit Freunden, die an der Manhattan School of Music waren, bin ich in Verdis „Nabucco“ an der Metropolitan Opera gegangen. Ich fand den berühmten Chor der Gefangenen darin so ergreifend, dass mir ein Freund daraufhin den Gefangenenchor aus „Fidelio“ gezeigt hat. Irgendwann habe ich dann auch die ganze Oper gesehen. Daraus hat sich eine Reihe ergeben, die ich immer zusammen rezipiert habe: Der Chor der Gefangenen aus „Nabucco“, aus „Fidelio“ und dann der Chor aus Beethovens neunter Sinfonie als utopische Vorstellung der Verbrüderung.
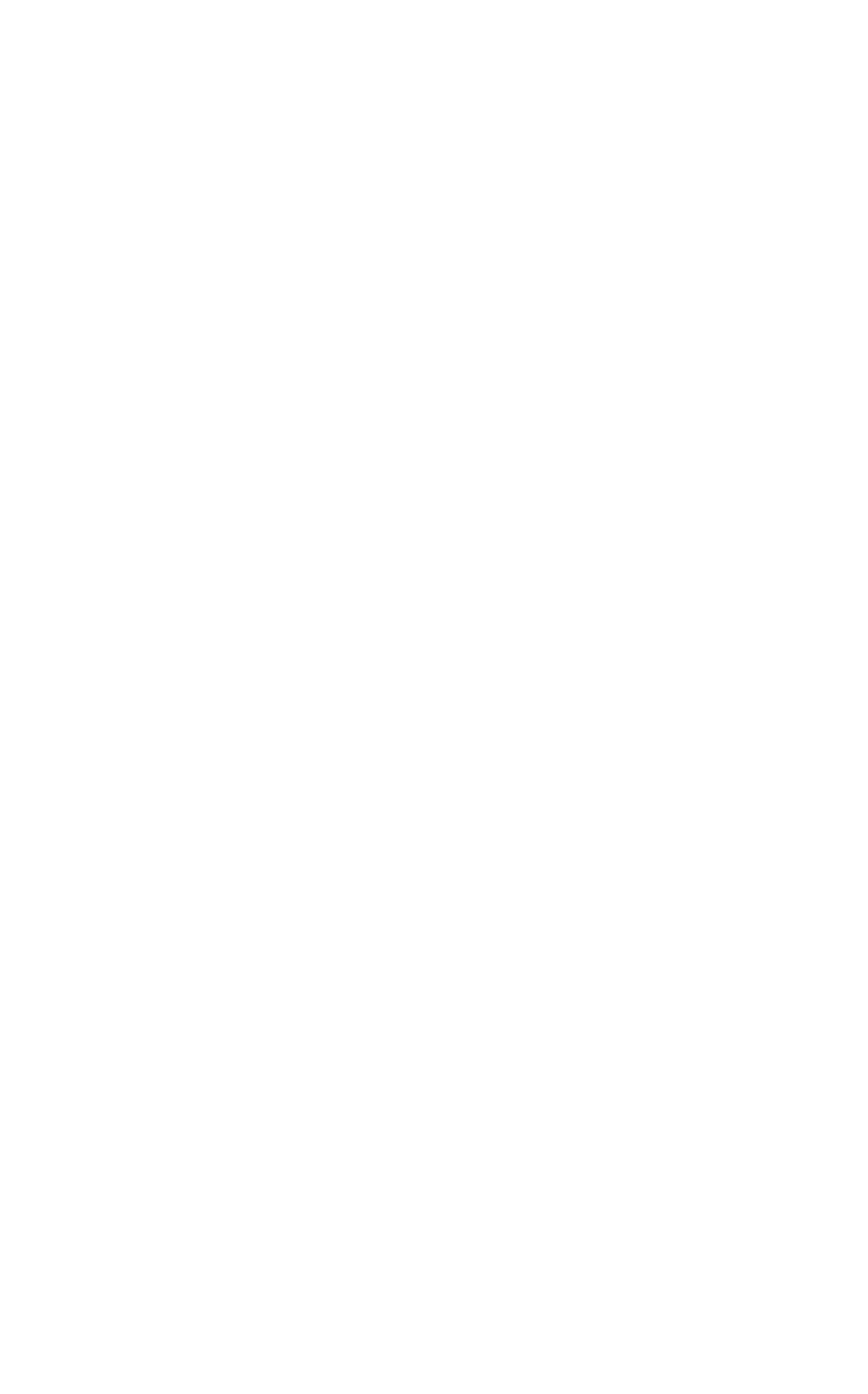
Vitali Alekseenok
© Liliya Namisnyk
VA: Das ist spannend, denn es zeigt, dass man die Musikgeschichte nicht chronologisch entdecken muss. Man kennt einiges sehr gut und das andere gar nicht, und sicherlich verändert sich die Wahrnehmung von „Fidelio“ nachdem man „Nabucco“ gehört hat, genauso wie umgekehrt.
KP: „Fidelio“ ist eine sehr ergreifende ‚Befreiungssoper‘, ihre Aufführungsgeschichte markiert verschiedene historische Ereignisse. Was für unser Projekt unerwartet war — Vitali und ich haben einander vor fünf Jahren ausgerechnet wegen einer Verhaftung kennengelernt, auf einer Demonstration am Potsdamer Platz in Berlin: Marija Kalesnikowa, eine der brillantesten Frauen ihrer Generation — Musikerin, Kuratorin, Mitbegründerin des Musikfestivals „Eklat“ in Stuttgart und oppositionelle Politikerin — wurde in Belarus verhaftet. Vitali kommt aus dem Land, das vor fünf Jahren gegen Wahlfälschung aufgestanden ist, es gab viel Hoffnung. Die Proteste wurden brutal unterdrückt. Noch heute sitzen deshalb tausende Menschen im Gefängnis. Ihr Schicksal ist völlig unklar. Auch das von Marija. Es ist reiner Zufall, dass wir uns plötzlich in diesem Projekt wiedersehen. Wir bringen beide verschiedene Kontexte mit, haben Berührungen mit der Musik und in besonderer Weise mit diesem inhaltlichen Erbe, weil wir eigentlich ganz aktuell mit den Themen, die diese Oper verhandelt, weiterleben.
KP: „Fidelio“ ist eine sehr ergreifende ‚Befreiungssoper‘, ihre Aufführungsgeschichte markiert verschiedene historische Ereignisse. Was für unser Projekt unerwartet war — Vitali und ich haben einander vor fünf Jahren ausgerechnet wegen einer Verhaftung kennengelernt, auf einer Demonstration am Potsdamer Platz in Berlin: Marija Kalesnikowa, eine der brillantesten Frauen ihrer Generation — Musikerin, Kuratorin, Mitbegründerin des Musikfestivals „Eklat“ in Stuttgart und oppositionelle Politikerin — wurde in Belarus verhaftet. Vitali kommt aus dem Land, das vor fünf Jahren gegen Wahlfälschung aufgestanden ist, es gab viel Hoffnung. Die Proteste wurden brutal unterdrückt. Noch heute sitzen deshalb tausende Menschen im Gefängnis. Ihr Schicksal ist völlig unklar. Auch das von Marija. Es ist reiner Zufall, dass wir uns plötzlich in diesem Projekt wiedersehen. Wir bringen beide verschiedene Kontexte mit, haben Berührungen mit der Musik und in besonderer Weise mit diesem inhaltlichen Erbe, weil wir eigentlich ganz aktuell mit den Themen, die diese Oper verhandelt, weiterleben.
Ist „Fidelio“ aus eurer Sicht ein politisches Werk?
VA: Jein. Vor allen Dingen ist es für mich ein großes Kunstwerk. Ob es als politisch wahrgenommen wird, hängt letztlich von seiner Rezeption ab und nicht von dem Werk an sich. „Fidelio“ wurde so oft interpretiert und auch instrumentalisiert. Die eigentliche Frage ist, was es bedeutet, ‚politisch‘ zu sein. Natürlich gibt es eine Ebene, wo das Politische und die Kunst sich mischen, wie auch zur Zeit der Uraufführung. Damals war Wien von den Franzosen besetzt und in so einer Zeit eine Befreiungsoper zu schreiben — ist das schon ein politisches Statement? Vielleicht hat Beethoven auch deshalb mit diesem Werk gehadert und es immer mehr verallgemeinert. Denn in der Oper steckt viel mehr als eine konkrete politische Situation.
KP: Für mich ist alles das ‚politisch‘, was in einer Zeit verankert ist. Es geht um sehr allgemeine Fragen von Freiheit, den Verhältnissen in der Gesellschaft. Und somit wird Beethoven immer wieder auch für politische Zwecke instrumentalisiert. „Fidelio“ ist aber auch eine Art historische Oper geworden, die wichtige Ereignisse in der Geschichte markiert. Zum Beispiel die Inszenierungen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zur Wiedereröffnung der Opernhäuser in Berlin, Dresden und Wien, oder auch kurz vor dem Mauerfall 1989 in Dresden. Das waren riesige Ereignisse und mit „Fidelio“ wurde damit die Sprache für eine bestimmte Zeit gefunden. Es ist auch interessant, wie die Oper immer wieder von ihrer Geschichte eingeholt wird. Das erste Libretto entstand in der französischen Revolution und Beethovens Premiere spielte dann eine Woche nach dem Einmarsch der Franzosen in Wien. Die Aristokraten flohen und im Saal saßen Franzosen, die überhaupt nicht gewöhnt waren, eine Oper auf Deutsch zu hören. Auch dieses Chaos ist historisch.
Was ist das Zeitlose an der Geschichte der Oper, das es ermöglicht, sie immer wieder zu erzählen?
VA: Ich denke, dass die Erzählung vor allem durch die Musik und Beethovens Persönlichkeit funktioniert. Die Geschichte berührt uns, selbst wenn sie ziemlich unglaubwürdig ist. In der Oper ist so eine Verkleidungsgeschichte ja auch nichts Neues, nur eben normalerweise eher typisch für die Opera buffa. Das Spiel mit ‚buffa‘ und ‚seria‘ ist auch das Spannende an dieser Oper. Der ganze erste Teil ist wortwörtlich ‚oberflächlich‘, denn wir sind noch nicht in der Tiefe des Kerkers. Es gibt ganz normale Menschen, die ihren Alltag leben. Mit dem zweiten Akt gibt es einen Cut. Vielleicht braucht es diese Helligkeit, diese Normalität an der Oberfläche, um den abscheulichen Zustand des Kerkers zeigen zu können. Beethoven begibt sich mit diesen Kontrasten in ein Spannungsfeld zwischen einer sehr innovativen Dramaturgie und handwerklichen, gattungsbedingten Schwierigkeiten.
VA: Jein. Vor allen Dingen ist es für mich ein großes Kunstwerk. Ob es als politisch wahrgenommen wird, hängt letztlich von seiner Rezeption ab und nicht von dem Werk an sich. „Fidelio“ wurde so oft interpretiert und auch instrumentalisiert. Die eigentliche Frage ist, was es bedeutet, ‚politisch‘ zu sein. Natürlich gibt es eine Ebene, wo das Politische und die Kunst sich mischen, wie auch zur Zeit der Uraufführung. Damals war Wien von den Franzosen besetzt und in so einer Zeit eine Befreiungsoper zu schreiben — ist das schon ein politisches Statement? Vielleicht hat Beethoven auch deshalb mit diesem Werk gehadert und es immer mehr verallgemeinert. Denn in der Oper steckt viel mehr als eine konkrete politische Situation.
KP: Für mich ist alles das ‚politisch‘, was in einer Zeit verankert ist. Es geht um sehr allgemeine Fragen von Freiheit, den Verhältnissen in der Gesellschaft. Und somit wird Beethoven immer wieder auch für politische Zwecke instrumentalisiert. „Fidelio“ ist aber auch eine Art historische Oper geworden, die wichtige Ereignisse in der Geschichte markiert. Zum Beispiel die Inszenierungen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zur Wiedereröffnung der Opernhäuser in Berlin, Dresden und Wien, oder auch kurz vor dem Mauerfall 1989 in Dresden. Das waren riesige Ereignisse und mit „Fidelio“ wurde damit die Sprache für eine bestimmte Zeit gefunden. Es ist auch interessant, wie die Oper immer wieder von ihrer Geschichte eingeholt wird. Das erste Libretto entstand in der französischen Revolution und Beethovens Premiere spielte dann eine Woche nach dem Einmarsch der Franzosen in Wien. Die Aristokraten flohen und im Saal saßen Franzosen, die überhaupt nicht gewöhnt waren, eine Oper auf Deutsch zu hören. Auch dieses Chaos ist historisch.
Was ist das Zeitlose an der Geschichte der Oper, das es ermöglicht, sie immer wieder zu erzählen?
VA: Ich denke, dass die Erzählung vor allem durch die Musik und Beethovens Persönlichkeit funktioniert. Die Geschichte berührt uns, selbst wenn sie ziemlich unglaubwürdig ist. In der Oper ist so eine Verkleidungsgeschichte ja auch nichts Neues, nur eben normalerweise eher typisch für die Opera buffa. Das Spiel mit ‚buffa‘ und ‚seria‘ ist auch das Spannende an dieser Oper. Der ganze erste Teil ist wortwörtlich ‚oberflächlich‘, denn wir sind noch nicht in der Tiefe des Kerkers. Es gibt ganz normale Menschen, die ihren Alltag leben. Mit dem zweiten Akt gibt es einen Cut. Vielleicht braucht es diese Helligkeit, diese Normalität an der Oberfläche, um den abscheulichen Zustand des Kerkers zeigen zu können. Beethoven begibt sich mit diesen Kontrasten in ein Spannungsfeld zwischen einer sehr innovativen Dramaturgie und handwerklichen, gattungsbedingten Schwierigkeiten.
KP: Das Libretto ist natürlich etwas unglaubwürdig, aber wer hat schon glaubwürdige Opernlibretti gesehen? Man staunt über die eigenen Gefühle, weil man bei Opern trotzdem mitkommt, mitleidet und fasziniert wird. Bei „Fidelio“ fragt man sich, wie dieser Alltag wirklich funktioniert. Wir können nicht alles verstehen und das ist auch schön, denn es gibt eine abstrakte Ebene. Für mich war interessant, wie sich Beethoven aus dieser Buffonade im ersten Akt befreit und damit in die Tiefe des Kerkers steigt. Auch deswegen habe ich als erste Intervention eine banale, fast alberne Alltagssituation ausgewählt, die in einen Abgrund führt. Gleichzeitig ist es eine dichte Dramaturgie, es gibt so viele Geschichten, die in „Fidelio“ angelegt sind: Die Befreiung aus dem Gefängnis, eine verdrehte „Orpheus und Eurydike“-Erzählung und alles wird innerhalb eines Tages erzählt. Und wir haben es mit zwei Konzepten von Befreiung zu tun, die aufeinanderprallen. Einerseits gibt es eine Frau, die seit zwei Jahren in diesem Gefängnis schuftet. Es geht um Ausdauer, Geduld und Treue. Andererseits gibt es den Minister, der genau im richtigen Moment auftaucht. Wir vergessen ganz und gar, dass Leonore bewaffnet ist und alle möglichen Optionen hat. Wichtig ist mir, dass diese Befreiung nicht nur von Leonore kommt, sondern von einem guten Machthaber. Es gibt ein Stück Hoffnung. Das Stück hat so viele Spuren von visionären politischen Denkern und steht zwischen klassizistischen Konzepten sozialer Gebilde und utopischen Vorstellungen von Gesellschaft. Gleichzeitig gibt es romantische Figuren, die für etwas kämpfen. Dabei geht es grundlegend um die Frage, was es eigentlich bedeutet, ein Mensch zu sein.
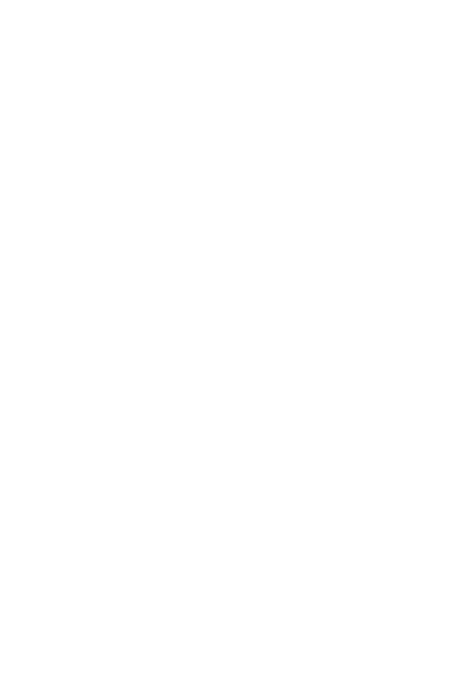
Katja Petrowskaja
© Sasha Andrusyk
Die Kontraste der ‚Welten‘ an der Oberfläche und in der Tiefe des Kerkers können wir natürlich auch in der Musik hören. Wie hat Beethoven die Unterwelt des Kerkers musikalisch gestaltet?
VA: Der zweite Akt beginnt mit einem tiefen f-Moll voller Dissonanzen, vom ersten Takt an hört man Dunkelheit. Durch krasse, verrückte Harmonik, Rhythmik und Orchestrierung entstehen sehr instabile, kontrastreiche musikalische Momente. Überhaupt hat das Vorspiel wenig Form. Es entsteht ein Eindruck von Zerrissenheit: Eigentlich passiert viel zu viel — nicht nur musikalisch gesehen, denn auch für Florestan ist jeder Tag im Kerker einer zu viel. Mich erinnert das an die erste Nummer aus Haydns „Schöpfung“, die erst wenige Jahre vor „Fidelio“ komponiert wurde. Haydn lässt die Welt aus dem finsteren Chaos entstehen. Man hört verschiedenste harmonische Klänge, die alles andere als normal klingen. Und genauso ist es im Vorspiel zu Florestan. Bei Haydn kommt dann der Chor und sagt „Und es ward Licht“. Plötzlich kommt dann ein strahlendes C-Dur. Bei Florestan ist es anders, er singt „Gott! Welch Dunkel hier!“ Wir bleiben in diesem Zustand der Dunkelheit ohne Licht. Das ist in der Musik genial dargestellt.
Wie lässt Beethoven dann am Schluss die Rückkehr ans Tageslicht klingen?
VA: Auch „Fidelio“ kommt zu einem strahlenden C-Dur, nur ca. eine Stunde später, ganz am Schluss. Im zweiten Akt erleben wir eine sinfonische Entwicklung aus der Dunkelheit in das Licht, in eine idealistische Vorstellung vom Menschsein. Es beginnt sehr düster, es gibt einen Konflikt, eine Auflösung, in der die Zeit kurz stehenzubleiben scheint, und dann ein triumphales Ende. Darin steckt auch dieses Konzept von „per aspera ad astra“— also wörtlich: ‚durch das Raue zu den Sternen‘. Wenn wir auf die ganze Oper schauen, hieße es eher ‚durch das Alltägliche, Banale zu den Idealen‘. Für den zweiten Akt gibt es also eine eigene konzeptuelle Form. Die Befreiungsoper findet eigentlich überwiegend darin statt. Das ist auch eine Parallele zur neunten Sinfonie, deren vierter Satz formell eigentlich selbst eine ganze Sinfonie ist. Bei „Fidelio“ funktioniert die Entwicklung hin zum Licht bereits durch die Figur Leonores und die empathische Darstellung der Gefangenen im ersten Akt. Mit der musikalischen Charakterisierung von Florestan und Leonore wendet sich Beethoven im zweiten Akt aber noch mehr von einer ‚normalen‘ Oper ab und schafft etwas Neues.
Warum eignet sich diese Oper, die so stark von der Form aus gedacht ist, dafür, sie gemeinsam mit neuen Texten aufzuführen?
VA: Hier muss eigentlich jeder selbst entscheiden, was die Gattung Singspiel heute, 2025, bedeutet. Wie stark ist die Musik mit dem Text verbunden? In welchem Maß sind wir eingeladen, beides einzeln zu betrachten? Ich glaube, es ist durchaus legitim, die Dialoge wegzunehmen. Wir sind noch einen weiteren Schritt gegangen, indem es ‚Textinterventionen‘ gibt. Ich finde die Idee von Katja total spannend, das so klar zu benennen. Sie ersetzen keinen Text, sondern lassen ganz bewusst etwas anderes entstehen. Ich bin sehr gespannt, das zu sehen und zu spüren!
KP: Für mich ist es ein Experiment! ‚Intervention‘ ist ein militärischer Begriff. Selbst Interveneur zu sein, ist für mich eine ungewohnte Rolle, vielleicht steht sie mir nicht zu. Das Verfahren der Intervention habe ich zum ersten Mal im Zusammenhang mit moderner Kunst wahrgenommen, komischerweise in Wien! Ich war im Kunsthistorischen Museum, wo die alten Meister hängen. Ich komme aus der akademischen Literaturwissenschaft, also bin ich daran gewöhnt, dem Werk, egal ob es ein Bild, eine Oper oder ein literarischer Text ist, zu dienen. In Wien gab es eine Intervention von Jan Fabre, der riesige Leinwände mit Kugelschreiber bemalt hatte — und der Effekt war unfassbar. Natürlich sind blaue Flächen nicht mit ideologischen oder politischen Inhalten gefüllt, aber es war eine Art Zäsur, als würden wir durch den Meerblick auf alte Meister schauen. Beim Schreiben für unsere Produktion von „Fidelio“ hat mich die Überlegung beschäftigt, dass ich vielleicht etwas mit Beethoven mache, was man eigentlich nicht darf. Darum war für mich erst die Arbeit mit der Oper an sich sehr wichtig. Ich habe viel über Beethovens Taubheit in Bezug zur Befreiung nachgedacht. Darüber, was es bedeutet, nicht hören zu können und trotzdem fähig zu sein, diese Musik zu schreiben. Ich habe mich gefragt, „Wie nähere ich mich diesem Koloss Beethoven?“. Auch Mauricio Kagel stellt diese Frage sehr ironisch in seinem Film „Ludwig van“. Beethoven ist so eine große Figur. Was letztendlich entstanden ist, hat, ehrlich gesagt, mit einer öffentlichen Verzweiflung zu tun. Was mache ich als kleiner Mensch in Zeiten mehrerer Kriege, die man nicht verschweigen kann? Aus dieser Verzweiflung und Unbeholfenheit sind die Texte entstanden. Der Krieg intervenierte in unser Leben, ich interveniere mit den Erzählungen aus dem Krieg. Für mich ist es sehr interessant, ob und wie das funktionieren wird.
Welche Menschen und Erzählungen begegnen uns in deinen Interventionen?
KP: Es gibt jetzt so viele Geschichten aus dem ukrainischen Krieg. Man hat das Gefühl, es ist ein Chor aus der griechischen Tragödie und mit meinen Texten bin ich nur eine Stimme von vielen. Die erste Geschichte habe ich bei mir zu Hause in Berlin erlebt. Sie handelt von einer Frau, von der ich nur weiß, dass sie vor dem Krieg geflüchtet ist, und dass sie auf keinen Fall darüber reden will. Ihre Mühe, sich täglich seelisch aufzurichten, normal zu leben, das hat mich an „Fidelio“ erinnert. Die erste Szene ist fast albern in ihrer Alltäglichkeit, wir haben gelacht, weil wir keinen Kaffee mehr trinken. Ohne es zu wissen, begegnen wir hunderttausenden Menschen, die jeden Tag eine Kriegstragödie erleben. Die Geschichte von Olena war so eine plötzliche Explosion neben mir. Die zweite Geschichte akkumuliert die Erfahrung mehrerer Menschen, die gleichzeitig in Freiheit und Unfreiheit leben. Die Kriegssituation ist eine Art Gefangenschaft: Man weiß überhaupt nicht weiter. Trotzdem lebt man einfach einen Alltag. Krieg und Frieden gleichzeitig. Was bedeutet da Freiheit? Ich hatte ein Gespräch mit einer Frau, die mir gesagt hat: „Wir brauchen Freiheit und deswegen fahren wir raus aus der Ukraine.“ Und dann: „Wir brauchen Freiheit, deswegen fahren wir zurück.“ Der dritte Text ist buchstäblich die Geschichte von „Fidelio“. Es geht um eine Frau aus Cherson. Ihre Geschichte hat mich erschüttert. Vor allem die Stimme dieser Frau. Ich habe insgesamt ca. 20 Stunden mit ihr gesprochen und konnte das alles gar nicht glauben. Eine Frau, hübsch und ziemlich jung, um die 35. Ihre Lust am Leben, an Liebe, an Erhaltung des Lebens, an der Zukunft ist einfach enorm. Vielleicht entsteht sie im Leiden noch viel mehr. Sie hat mir erzählt, wie sie nach ihrem von Russen verhafteten Mann gesucht hat, überall — in den russischen Behörden, in den Gefängnissen — obwohl klar ist, dass sie foltern, dass sie Frauen vergewaltigen, und dass die Menschen einfach verschwinden. Nachdem sie ihn in einem Kriegsgefängnis fand, hat sie ihn und fast 30 andere ukrainische Häftlinge monatelang eigenhändig mit Medikamenten und Essen versorgt. Als er überraschend befreit wurde, mussten die beiden einen über 1000 Kilometer langen Umweg machen, weil sie nicht durch Front zurück nach Hause konnten. Dann wurde er erneut verhaftet und nach Russland gebracht. Sie ist ihm gefolgt und hat wieder Unmögliches geleistet — eine Geschichte mit einer beinah inflationären Menge an Wundern. Die letzte Intervention hat nichts mit dem aktuellen Krieg zu tun, aber sie tastet sich an Vorstellungen von Alltag, Krieg und Freiheit heran. Sie basiert auf den wenigen Seiten eines Tagebuchs von einer Frau, die 1944 verhaftet wurde und in ein polnisches KZ kam. Ihr Tagebuch erzählt vom ersten Tag der Befreiung bis zwei Wochen danach. Sie erlebt den Wahnsinn dieser Befreiung im Frühling 1945 und denkt an „Fidelio“. Später stellt sie fest, dass ein Happy End nur bedeutet, rechtzeitig aufzuhören zu schreiben. Es ist auch eine Frage an die Oper: Wir steigen in dem Moment der Befreiung und der Vereinigungen der Liebenden aus. Doch was passiert am nächsten Tag? Ob die Liebe besteht? Bei Magda gibt es am Ende noch eine Trumpfkarte. Es steht nicht in ihrem Tagebuch, aber durch Recherchen fand ich heraus, dass sie dank einer Scheinehe nach Amerika auswandern konnte — und diese Scheinehe wurde ihre ewige Liebe. Einer ihrer Verwandten erzählte mir, dass es eine der glücklichsten Ehen geworden ist, die er in seinem Leben kannte. Das bedeutet aber nicht, dass diese Menschen nicht jeden Tag an ihrer Liebe gearbeitet haben.
VA: Der zweite Akt beginnt mit einem tiefen f-Moll voller Dissonanzen, vom ersten Takt an hört man Dunkelheit. Durch krasse, verrückte Harmonik, Rhythmik und Orchestrierung entstehen sehr instabile, kontrastreiche musikalische Momente. Überhaupt hat das Vorspiel wenig Form. Es entsteht ein Eindruck von Zerrissenheit: Eigentlich passiert viel zu viel — nicht nur musikalisch gesehen, denn auch für Florestan ist jeder Tag im Kerker einer zu viel. Mich erinnert das an die erste Nummer aus Haydns „Schöpfung“, die erst wenige Jahre vor „Fidelio“ komponiert wurde. Haydn lässt die Welt aus dem finsteren Chaos entstehen. Man hört verschiedenste harmonische Klänge, die alles andere als normal klingen. Und genauso ist es im Vorspiel zu Florestan. Bei Haydn kommt dann der Chor und sagt „Und es ward Licht“. Plötzlich kommt dann ein strahlendes C-Dur. Bei Florestan ist es anders, er singt „Gott! Welch Dunkel hier!“ Wir bleiben in diesem Zustand der Dunkelheit ohne Licht. Das ist in der Musik genial dargestellt.
Wie lässt Beethoven dann am Schluss die Rückkehr ans Tageslicht klingen?
VA: Auch „Fidelio“ kommt zu einem strahlenden C-Dur, nur ca. eine Stunde später, ganz am Schluss. Im zweiten Akt erleben wir eine sinfonische Entwicklung aus der Dunkelheit in das Licht, in eine idealistische Vorstellung vom Menschsein. Es beginnt sehr düster, es gibt einen Konflikt, eine Auflösung, in der die Zeit kurz stehenzubleiben scheint, und dann ein triumphales Ende. Darin steckt auch dieses Konzept von „per aspera ad astra“— also wörtlich: ‚durch das Raue zu den Sternen‘. Wenn wir auf die ganze Oper schauen, hieße es eher ‚durch das Alltägliche, Banale zu den Idealen‘. Für den zweiten Akt gibt es also eine eigene konzeptuelle Form. Die Befreiungsoper findet eigentlich überwiegend darin statt. Das ist auch eine Parallele zur neunten Sinfonie, deren vierter Satz formell eigentlich selbst eine ganze Sinfonie ist. Bei „Fidelio“ funktioniert die Entwicklung hin zum Licht bereits durch die Figur Leonores und die empathische Darstellung der Gefangenen im ersten Akt. Mit der musikalischen Charakterisierung von Florestan und Leonore wendet sich Beethoven im zweiten Akt aber noch mehr von einer ‚normalen‘ Oper ab und schafft etwas Neues.
Warum eignet sich diese Oper, die so stark von der Form aus gedacht ist, dafür, sie gemeinsam mit neuen Texten aufzuführen?
VA: Hier muss eigentlich jeder selbst entscheiden, was die Gattung Singspiel heute, 2025, bedeutet. Wie stark ist die Musik mit dem Text verbunden? In welchem Maß sind wir eingeladen, beides einzeln zu betrachten? Ich glaube, es ist durchaus legitim, die Dialoge wegzunehmen. Wir sind noch einen weiteren Schritt gegangen, indem es ‚Textinterventionen‘ gibt. Ich finde die Idee von Katja total spannend, das so klar zu benennen. Sie ersetzen keinen Text, sondern lassen ganz bewusst etwas anderes entstehen. Ich bin sehr gespannt, das zu sehen und zu spüren!
KP: Für mich ist es ein Experiment! ‚Intervention‘ ist ein militärischer Begriff. Selbst Interveneur zu sein, ist für mich eine ungewohnte Rolle, vielleicht steht sie mir nicht zu. Das Verfahren der Intervention habe ich zum ersten Mal im Zusammenhang mit moderner Kunst wahrgenommen, komischerweise in Wien! Ich war im Kunsthistorischen Museum, wo die alten Meister hängen. Ich komme aus der akademischen Literaturwissenschaft, also bin ich daran gewöhnt, dem Werk, egal ob es ein Bild, eine Oper oder ein literarischer Text ist, zu dienen. In Wien gab es eine Intervention von Jan Fabre, der riesige Leinwände mit Kugelschreiber bemalt hatte — und der Effekt war unfassbar. Natürlich sind blaue Flächen nicht mit ideologischen oder politischen Inhalten gefüllt, aber es war eine Art Zäsur, als würden wir durch den Meerblick auf alte Meister schauen. Beim Schreiben für unsere Produktion von „Fidelio“ hat mich die Überlegung beschäftigt, dass ich vielleicht etwas mit Beethoven mache, was man eigentlich nicht darf. Darum war für mich erst die Arbeit mit der Oper an sich sehr wichtig. Ich habe viel über Beethovens Taubheit in Bezug zur Befreiung nachgedacht. Darüber, was es bedeutet, nicht hören zu können und trotzdem fähig zu sein, diese Musik zu schreiben. Ich habe mich gefragt, „Wie nähere ich mich diesem Koloss Beethoven?“. Auch Mauricio Kagel stellt diese Frage sehr ironisch in seinem Film „Ludwig van“. Beethoven ist so eine große Figur. Was letztendlich entstanden ist, hat, ehrlich gesagt, mit einer öffentlichen Verzweiflung zu tun. Was mache ich als kleiner Mensch in Zeiten mehrerer Kriege, die man nicht verschweigen kann? Aus dieser Verzweiflung und Unbeholfenheit sind die Texte entstanden. Der Krieg intervenierte in unser Leben, ich interveniere mit den Erzählungen aus dem Krieg. Für mich ist es sehr interessant, ob und wie das funktionieren wird.
Welche Menschen und Erzählungen begegnen uns in deinen Interventionen?
KP: Es gibt jetzt so viele Geschichten aus dem ukrainischen Krieg. Man hat das Gefühl, es ist ein Chor aus der griechischen Tragödie und mit meinen Texten bin ich nur eine Stimme von vielen. Die erste Geschichte habe ich bei mir zu Hause in Berlin erlebt. Sie handelt von einer Frau, von der ich nur weiß, dass sie vor dem Krieg geflüchtet ist, und dass sie auf keinen Fall darüber reden will. Ihre Mühe, sich täglich seelisch aufzurichten, normal zu leben, das hat mich an „Fidelio“ erinnert. Die erste Szene ist fast albern in ihrer Alltäglichkeit, wir haben gelacht, weil wir keinen Kaffee mehr trinken. Ohne es zu wissen, begegnen wir hunderttausenden Menschen, die jeden Tag eine Kriegstragödie erleben. Die Geschichte von Olena war so eine plötzliche Explosion neben mir. Die zweite Geschichte akkumuliert die Erfahrung mehrerer Menschen, die gleichzeitig in Freiheit und Unfreiheit leben. Die Kriegssituation ist eine Art Gefangenschaft: Man weiß überhaupt nicht weiter. Trotzdem lebt man einfach einen Alltag. Krieg und Frieden gleichzeitig. Was bedeutet da Freiheit? Ich hatte ein Gespräch mit einer Frau, die mir gesagt hat: „Wir brauchen Freiheit und deswegen fahren wir raus aus der Ukraine.“ Und dann: „Wir brauchen Freiheit, deswegen fahren wir zurück.“ Der dritte Text ist buchstäblich die Geschichte von „Fidelio“. Es geht um eine Frau aus Cherson. Ihre Geschichte hat mich erschüttert. Vor allem die Stimme dieser Frau. Ich habe insgesamt ca. 20 Stunden mit ihr gesprochen und konnte das alles gar nicht glauben. Eine Frau, hübsch und ziemlich jung, um die 35. Ihre Lust am Leben, an Liebe, an Erhaltung des Lebens, an der Zukunft ist einfach enorm. Vielleicht entsteht sie im Leiden noch viel mehr. Sie hat mir erzählt, wie sie nach ihrem von Russen verhafteten Mann gesucht hat, überall — in den russischen Behörden, in den Gefängnissen — obwohl klar ist, dass sie foltern, dass sie Frauen vergewaltigen, und dass die Menschen einfach verschwinden. Nachdem sie ihn in einem Kriegsgefängnis fand, hat sie ihn und fast 30 andere ukrainische Häftlinge monatelang eigenhändig mit Medikamenten und Essen versorgt. Als er überraschend befreit wurde, mussten die beiden einen über 1000 Kilometer langen Umweg machen, weil sie nicht durch Front zurück nach Hause konnten. Dann wurde er erneut verhaftet und nach Russland gebracht. Sie ist ihm gefolgt und hat wieder Unmögliches geleistet — eine Geschichte mit einer beinah inflationären Menge an Wundern. Die letzte Intervention hat nichts mit dem aktuellen Krieg zu tun, aber sie tastet sich an Vorstellungen von Alltag, Krieg und Freiheit heran. Sie basiert auf den wenigen Seiten eines Tagebuchs von einer Frau, die 1944 verhaftet wurde und in ein polnisches KZ kam. Ihr Tagebuch erzählt vom ersten Tag der Befreiung bis zwei Wochen danach. Sie erlebt den Wahnsinn dieser Befreiung im Frühling 1945 und denkt an „Fidelio“. Später stellt sie fest, dass ein Happy End nur bedeutet, rechtzeitig aufzuhören zu schreiben. Es ist auch eine Frage an die Oper: Wir steigen in dem Moment der Befreiung und der Vereinigungen der Liebenden aus. Doch was passiert am nächsten Tag? Ob die Liebe besteht? Bei Magda gibt es am Ende noch eine Trumpfkarte. Es steht nicht in ihrem Tagebuch, aber durch Recherchen fand ich heraus, dass sie dank einer Scheinehe nach Amerika auswandern konnte — und diese Scheinehe wurde ihre ewige Liebe. Einer ihrer Verwandten erzählte mir, dass es eine der glücklichsten Ehen geworden ist, die er in seinem Leben kannte. Das bedeutet aber nicht, dass diese Menschen nicht jeden Tag an ihrer Liebe gearbeitet haben.
Programmheft
Das Programmheft zu „Fidelio“ ist bei jeder Vorstellung erhältlich. Eine digitale Version können Sie hier herunterladen:
Handlung
Seit zwei Jahren gilt Florestan als verschollen, doch seine Frau Leonore vermutet ihn in der Gefangenschaft des Kerkermeisters Rocco. Sie verkleidet sich als Mann und beginnt unter dem Decknamen „Fidelio“ im Gefängnis zu arbeiten, um Gewissheit über den Verbleib Florestans zu bekommen. Die Vertuschung ihrer wahren Identität gelingt — so sehr, dass Marzelline, die Tochter des Kerkermeisters, sich in Fidelio verliebt.
ERSTER AUFZUG
Jaquino, der Pförtner des Gefängnisses, versucht Marzelline einen Heiratsantrag zu machen, doch sie lässt ihn abblitzen und träumt stattdessen von ihrem zukünftigen Eheglück mit Fidelio. Auch Rocco begrüßt die Verbindung seiner Tochter mit Fidelio, während Leonore ihr Inkognito davon gefährdet sieht. Doch sie nutzt das Vertrauen des Kerkermeisters, um an Informationen über Florestan zu kommen. So berichtet Rocco von einem geheimen Kerker, in dem ein unbekannter Häftling unter menschenunwürdigen Bedingungen gefangen
gehalten wird. Nach neuen Anweisungen des Gouverneurs lässt Rocco den Insassen langsam verhungern. Leonore bittet Rocco, ihn in den Kerker begleiten zu dürfen. Rocco verspricht ihr, den Gouverneur Don Pizarro um Erlaubnis dafür zu fragen. Pizarro hat von einem Informanten erfahren, dass Minister Don Fernando über willkürliche
Gewalt im Staatsgefängnis in Kenntnis gesetzt wurde und zu einer Überprüfung dieser
Zustände aufbrechen wird. Pizarro beschließt, seinen geheimen Insassen endgültig verschwinden
zu lassen, und beauftragt den Kerkermeister mit dem Mord. Rocco weigert sich, für Pizarro zu töten, doch er erklärt sich immerhin bereit, ein Grab auszuheben. Leonore hat alles gehört und bittet Rocco mit neuer Entschlossenheit, den Gefangenen einen Spaziergang im Festungsgarten zu gestatten. Die Gefangenen treten ins Tageslicht hinaus.
Unterdessen hat der Gouverneur Fidelios Mitarbeit im unterirdischen Kerker zugestimmt. Fidelio und Rocco sollen unverzüglich beginnen, in einer Zisterne ein Grab für den unbekannten
Gefangenen auszuheben. Da stürzen Marzelline und Jaquino herein: Pizarro sei außer sich, denn er habe vom Freigang der Häftlinge erfahren. Rocco beruhigt den Gouverneur und die Gefangenen kehren zurück in ihre Zellen.
ZWEITER AUFZUG
Eingeschlossen in ein dunkles unterirdisches Verlies träumt Florestan von Leonore. Er sieht einen Engel vor sich erscheinen, ehe er erschöpft das Bewusstsein verliert. Derweil erreichen Rocco und Leonore das Kellergewölbe und machen sich an die Arbeit. Während sie gräbt, entschließt sich Leonore den hilfsbedürftigen Gefangenen vor Pizarro zu schützen, egal ob es ihr Florestan ist, oder nicht. Als der Insasse erwacht, erkennt sie ihren Mann. Rocco
gibt Florestan etwas zu trinken, Leonore, die von Florestan nicht erkannt wird, reicht ihm ein Stück Brot. Schließlich tritt Pizarro in den Kerker. Als er sich auf Florestan stürzt, stellt Leonore sich ihm in den Weg und gibt ihre wahre Identität preis. Da erklingt ein Trompetensignal, das die Ankunft des Ministers verkündet. Florestan und Leonore fallen sich in die Arme, Pizarros Macht ist gebrochen. Der Minister empfängt die Gefangenen und das Volk
und kündigt Gerechtigkeit und Gnade an, Leonore wird gefeiert.
ERSTER AUFZUG
Jaquino, der Pförtner des Gefängnisses, versucht Marzelline einen Heiratsantrag zu machen, doch sie lässt ihn abblitzen und träumt stattdessen von ihrem zukünftigen Eheglück mit Fidelio. Auch Rocco begrüßt die Verbindung seiner Tochter mit Fidelio, während Leonore ihr Inkognito davon gefährdet sieht. Doch sie nutzt das Vertrauen des Kerkermeisters, um an Informationen über Florestan zu kommen. So berichtet Rocco von einem geheimen Kerker, in dem ein unbekannter Häftling unter menschenunwürdigen Bedingungen gefangen
gehalten wird. Nach neuen Anweisungen des Gouverneurs lässt Rocco den Insassen langsam verhungern. Leonore bittet Rocco, ihn in den Kerker begleiten zu dürfen. Rocco verspricht ihr, den Gouverneur Don Pizarro um Erlaubnis dafür zu fragen. Pizarro hat von einem Informanten erfahren, dass Minister Don Fernando über willkürliche
Gewalt im Staatsgefängnis in Kenntnis gesetzt wurde und zu einer Überprüfung dieser
Zustände aufbrechen wird. Pizarro beschließt, seinen geheimen Insassen endgültig verschwinden
zu lassen, und beauftragt den Kerkermeister mit dem Mord. Rocco weigert sich, für Pizarro zu töten, doch er erklärt sich immerhin bereit, ein Grab auszuheben. Leonore hat alles gehört und bittet Rocco mit neuer Entschlossenheit, den Gefangenen einen Spaziergang im Festungsgarten zu gestatten. Die Gefangenen treten ins Tageslicht hinaus.
Unterdessen hat der Gouverneur Fidelios Mitarbeit im unterirdischen Kerker zugestimmt. Fidelio und Rocco sollen unverzüglich beginnen, in einer Zisterne ein Grab für den unbekannten
Gefangenen auszuheben. Da stürzen Marzelline und Jaquino herein: Pizarro sei außer sich, denn er habe vom Freigang der Häftlinge erfahren. Rocco beruhigt den Gouverneur und die Gefangenen kehren zurück in ihre Zellen.
ZWEITER AUFZUG
Eingeschlossen in ein dunkles unterirdisches Verlies träumt Florestan von Leonore. Er sieht einen Engel vor sich erscheinen, ehe er erschöpft das Bewusstsein verliert. Derweil erreichen Rocco und Leonore das Kellergewölbe und machen sich an die Arbeit. Während sie gräbt, entschließt sich Leonore den hilfsbedürftigen Gefangenen vor Pizarro zu schützen, egal ob es ihr Florestan ist, oder nicht. Als der Insasse erwacht, erkennt sie ihren Mann. Rocco
gibt Florestan etwas zu trinken, Leonore, die von Florestan nicht erkannt wird, reicht ihm ein Stück Brot. Schließlich tritt Pizarro in den Kerker. Als er sich auf Florestan stürzt, stellt Leonore sich ihm in den Weg und gibt ihre wahre Identität preis. Da erklingt ein Trompetensignal, das die Ankunft des Ministers verkündet. Florestan und Leonore fallen sich in die Arme, Pizarros Macht ist gebrochen. Der Minister empfängt die Gefangenen und das Volk
und kündigt Gerechtigkeit und Gnade an, Leonore wird gefeiert.
Opernführer Audio
Einen kurzen Einblick in die Produktion gibt Ihnen hier Dramaturgin Katie Campbell. Den Opernführer in der Live-Version können Sie 60 Minuten vor jeder Vorstellung in der Philharmonie Mercatorhalle erleben.
Dauer: 13:03 Minuten
Dauer: 13:03 Minuten